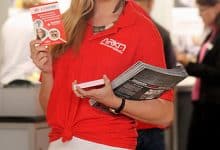Die Entwicklung virtueller und hybrider Events – Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand
Neue Realität durch Digitalisierung und Pandemie
Die Veranstaltungsbranche hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt. Spätestens seit der COVID-19-Pandemie ist klar, dass virtuelle und hybride Formate keine Übergangslösung mehr sind, sondern ein fester Bestandteil der Eventlandschaft. Digitalisierung und globale Krisen haben nicht nur technische Innovationen beschleunigt, sondern auch Erwartungen und Anforderungen von Teilnehmern und Veranstaltern nachhaltig verändert.
Während früher persönliche Begegnungen im Mittelpunkt standen und digitale Übertragungen höchstens eine Randnotiz waren, sind virtuelle Elemente heute selbstverständlich. Sie reichen von Live-Streams und digitalen Plattformen bis hin zu komplexen Event-Ökosystemen, die Teilnehmer vor, während und nach einer Veranstaltung begleiten. Entscheidend ist dabei nicht allein die Technik, sondern die Integration digitaler und physischer Elemente zu einem stimmigen Gesamterlebnis.
„Wir sehen, dass Events heute viel stärker hybrid gedacht werden. Virtuelle Elemente sind nicht mehr nur eine Notlösung, sondern ein fester Bestandteil, der Reichweite, Inklusion und Nachhaltigkeit fördert. Gleichzeitig bleibt das persönliche Treffen unersetzlich. Die Kunst liegt darin, beides intelligent zu verbinden“, betont Larissa Steinbäcker, Co-CEO der Proske GmbH.
Verschobene Erwartungshaltung bei Teilnehmenden
Die Pandemie hat gezeigt, dass digitale Teilnahme funktioniert, und dabei oft sogar Vorteile bringt. Mitarbeitende, Geschäftspartner oder Kunden müssen nicht mehr zwingend reisen, um an relevanten Veranstaltungen teilzunehmen. Gleichzeitig haben viele die persönliche Begegnung schätzen gelernt, die virtuell nicht vollständig ersetzt werden kann. Diese Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, von physischer Präsenz und digitalem Zugang, prägt die Erwartungshaltung heute stärker denn je.
Studien belegen zudem, dass Teilnehmende heute Flexibilität erwarten. Sie wollen selbst entscheiden, ob sie physisch vor Ort, virtuell oder in einem Mischformat teilnehmen. Hybride Events tragen diesem Bedürfnis Rechnung, indem sie beides kombinieren: Die Intensität des persönlichen Austauschs und die Reichweite digitaler Tools.
Nachhaltigkeit als zusätzlicher Treiber
Neben Flexibilität ist Nachhaltigkeit ein weiterer Grund für die Etablierung hybrider Formate. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Flugreisen für internationale Kongresse, gedruckte Materialien oder aufwändige Messebauten geraten in den Fokus von Nachhaltigkeitsstrategien. Virtuelle Elemente bieten hier einen klaren Vorteil, schließlich verringern sie Reiseaufkommen, reduzieren Ressourcenverbrauch und machen Veranstaltungen für eine breitere Zielgruppe zugänglich – auch für Menschen, die aus gesundheitlichen, finanziellen oder geografischen Gründen nicht reisen können.
Daten und Messbarkeit gewinnen an Bedeutung

Ein wesentlicher Unterschied zwischen klassischen und hybriden Events liegt in der Datenebene. Während früher Erfolg oft an weichen Faktoren wie Stimmung oder Networking-Möglichkeiten gemessen wurde, erlauben digitale Elemente heute eine detaillierte Analyse. Klickzahlen, Verweildauer, Interaktionen im Chat oder Abstimmungen liefern konkrete Indikatoren für Reichweite und Wirkung.
Gerade mittelständische Unternehmen, die ihre Budgets präzise einsetzen müssen, profitieren von dieser Messbarkeit. „Gerade für den Mittelstand bieten hybride Events enorme Chancen: Sie ermöglichen eine kosteneffiziente Teilnahme, weltweite Reichweite und messbare Daten zur Erfolgskontrolle. Dadurch werden Budgets effizienter eingesetzt und die Wirkung der Veranstaltung deutlich erhöht“, erklärt Larissa Steinbäcker weiter.
Hybride Events als Chance für den Mittelstand
Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) war es traditionell schwieriger, sich auf internationalen Leitmessen oder Konferenzen zu präsentieren. Hohe Reise- und Logistikkosten stellten eine Eintrittsbarriere dar. Digitale und hybride Formate senken diese Hürden erheblich. Virtuelle Messestände, digitale Produktpräsentationen oder hybride Workshops erlauben es auch kleineren Unternehmen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und internationale Märkte zu erreichen, ohne die Budgets überzustrapazieren.
Zugleich eröffnen hybride Formate neue Möglichkeiten der Interaktion. Virtuelle Networking-Räume, Matchmaking-Algorithmen oder On-Demand-Bibliotheken verlängern die Lebensdauer einer Veranstaltung über den eigentlichen Termin hinaus. Inhalte sind damit nicht mehr auf ein bestimmtes Datum beschränkt, sondern können jederzeit abgerufen werden.
Herausforderungen bleiben bestehen
Doch die Entwicklung bringt auch Herausforderungen mit sich. Eine davon ist die technische Umsetzung. Hybride Events erfordern eine stabile digitale Infrastruktur, von der Streaming-Technik bis zur Benutzerfreundlichkeit der Plattformen. Insbesondere kleine Unternehmen stehen vor der Frage, ob sie diese Ressourcen selbst aufbauen oder spezialisierte Partner beauftragen.
Ein zweiter Punkt betrifft die inhaltliche Gestaltung. Ein hybrides Event ist nicht einfach ein Live-Event mit Kamera, sondern verlangt ein durchdachtes Konzept, das beide Teilnehmergruppen, sowohl physisch als auch digital, gleichwertig berücksichtigt. Das erfordert eine präzise Regie, kreative Formate und eine klare Dramaturgie, die im digitalen Raum ebenso trägt wie im Saal.
Ausblick: Die Zukunft ist hybrid
Die Veranstaltungswelt steht vor einer dauerhaften Transformation. Digitale Elemente sind gekommen, um zu bleiben, während persönliche Begegnungen weiterhin unverzichtbar bleiben. Für Unternehmen, insbesondere für den Mittelstand, liegt die Herausforderung darin, die richtige Balance zu finden und die Chancen hybrider Formate strategisch zu nutzen.
Die Verbindung von Reichweite, Nachhaltigkeit und messbarer Wirkung zeigt, dass hybride Events nicht nur eine Reaktion auf Krisen sind, sondern ein Modell für die Zukunft. Sie erweitern Handlungsspielräume, senken Kosten und eröffnen neue Märkte. Wer frühzeitig in entsprechende Konzepte investiert, kann sich Wettbewerbsvorteile sichern und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren und inklusiveren Eventkultur leisten.