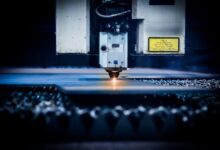Wie Think Tanks ihre Recherchen strukturieren
Think Tanks sind ein zentraler Bestandteil der politischen Meinungsbildung und Strategieentwicklung. Sie liefern evidenzbasierte Analysen, entwickeln Handlungsempfehlungen und bringen sich aktiv in öffentliche Debatten ein. Damit diese Arbeit Wirkung entfalten kann, ist eine strukturierte und methodisch fundierte Recherche essenziell. Doch wie gelingt es sogenannten Denkfabriken, ihre Forschungsprozesse effizient zu organisieren – und gleichzeitig flexibel auf politische Entwicklungen zu reagieren?
Forschung als Fundament
Unabhängig von Ausrichtung, Größe oder Geschäftsmodell ist Forschung das Fundament jedes Think Tanks. Ob wirtschaftspolitische Analysen, sicherheitspolitische Studien oder gesellschaftliche Trendforschung – die Qualität der Ergebnisse hängt maßgeblich von der Struktur der zugrunde liegenden Recherche ab.
Dabei existieren unterschiedliche Modelle: Manche Organisationen arbeiten mit fest angestellten Forscher:innen (Inhouse-Modell), andere setzen auf externe Expert:innen oder projektbezogene Kooperationen (Netzwerk-Modell). Viele Think Tanks kombinieren beide Ansätze, um sowohl Kontinuität als auch thematische Flexibilität zu gewährleisten.
Von der Idee zur Agenda
Eine strukturierte Recherche beginnt mit einer klar definierten Forschungsagenda. Diese dient als strategischer Rahmen, der die inhaltliche Ausrichtung vorgibt und Prioritäten setzt. Eine gute Agenda ist nicht statisch, sondern dynamisch – sie reagiert auf gesellschaftliche Entwicklungen, politische Debatten und neue Erkenntnisse.
Wichtige Bestandteile einer Forschungsagenda sind:
- Kontextanalyse: Welche politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflussen das Thema?
- Forschungsfragen: Welche konkreten Fragen sollen beantwortet werden?
- Zielgruppen: Wer soll mit den Ergebnissen erreicht werden – Politik, Öffentlichkeit, Fachkreise?
- Methodik: Welche qualitativen oder quantitativen Verfahren sind geeignet?
- Ressourcenplanung: Welche personellen und technischen Mittel stehen zur Verfügung?
Die Agenda sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden, um Relevanz und Anschlussfähigkeit sicherzustellen.
Teamstruktur und Rollenverteilung
Die Organisation der Forschung hängt stark von der internen Struktur des Think Tanks ab. Im sogenannten „Solo-Star-Modell“ arbeiten profilierte Forscher:innen weitgehend eigenständig, unterstützt von Assistent:innen. Ihre persönliche Expertise prägt die Agenda maßgeblich.
Im „Team-Modell“ hingegen erfolgt die Forschung in koordinierten Gruppen, oft in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen oder externen Berater:innen. Diese Struktur eignet sich besonders für groß angelegte Studien, Evaluationen oder interdisziplinäre Projekte.
Unabhängig vom Modell ist eine klare Rollenverteilung entscheidend: Projektleitung, Redaktion, Datenanalyse, Kommunikation – jede Funktion sollte definiert und mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein.
Qualitätssicherung und Peer Review
Glaubwürdigkeit steht und fällt mit der Qualität der Forschung. Daher sind interne Kontrollmechanismen unerlässlich. Dazu zählen:
- Methodenprüfung: Ist die gewählte Methodik geeignet und nachvollziehbar?
- Datenvalidierung: Sind die verwendeten Daten aktuell, zuverlässig und korrekt?
- Transparenz: Werden Quellen und Annahmen offen gelegt?
- Peer Review: Externe oder interne Fachleute prüfen die Arbeit vor Veröffentlichung.
Ein strukturierter Peer-Review-Prozess signalisiert nicht nur wissenschaftliche Sorgfalt, sondern stärkt auch das Vertrauen von Stakeholdern und Förderinstitutionen.
Moderne Think Tanks arbeiten zudem zunehmend digital. Recherchen, Datenanalysen, Textentwürfe und Präsentationen entstehen in vernetzten Systemen. Eine sichere und leistungsfähige digitale Infrastruktur mit Cloud-Lösungen für Unternehmen ist daher unverzichtbar. So lassen sich Dokumente sicher teilen, Versionen verwalten und Zugriffsrechte flexibel steuern – ohne Kompromisse bei der Vertraulichkeit.
Policy-Relevanz und Wirkung
Dabei wird nicht im luftleeren Raum geforscht. Ihre Arbeit soll politische Entscheidungen beeinflussen, gesellschaftliche Debatten anstoßen und konkrete Lösungen anbieten. Damit dies gelingt, muss die Forschung „policy-relevant“ sein – also:
- Kontextbezogen: Sie greift aktuelle Herausforderungen auf.
- Zielgerichtet: Sie beantwortet konkrete politische Fragen.
- Zeitnah: Sie erscheint zum richtigen Zeitpunkt im politischen Zyklus.
- Kommunikativ: Sie wird verständlich und zugänglich präsentiert.
Der Dialog mit Entscheidungsträger:innen sollte frühzeitig beginnen; idealerweise bereits in der Konzeptionsphase. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ergebnisse aufgegriffen und umgesetzt werden.
Finanzierung und Unabhängigkeit
Die Struktur der Recherche hängt auch von der Finanzierung ab. Think Tanks mit Grundförderung können langfristige Themen verfolgen und eigene Schwerpunkte setzen. Projektfinanzierte Einrichtungen sind stärker an den Interessen von Auftraggebern orientiert und müssen ihre Agenda flexibel anpassen.
Unabhängigkeit ist dabei ein zentrales Gut. Sie entsteht durch transparente Strukturen, vielfältige Finanzierungsquellen und eine klare Trennung von Forschung und Interessenvertretung. Nur so können Think Tanks glaubwürdig agieren und Vertrauen aufbauen.
In einer komplexen Welt, in der politische Entscheidungen immer schneller getroffen werden müssen, sind gut organisierte Denkfabriken unverzichtbar. Sie liefern nicht nur Wissen, sondern Orientierung – und tragen dazu bei, dass Politik auf Fakten statt auf Meinungen basiert.